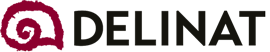PIWIs: Pilzwiderstandsfähige Rebsorten sorgen für eine Zeitenwende im ökologischen Weinbau
PIWI, das ist das Kürzel für pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Und die treffen wir immer häufiger in den Weinbergen an. Es sind gezüchtete Rebsorten, die resistent sind gegen einige der grössten Herausforderungen im modernen Weinbau. Es handelt sich um den Pilzbefall durch den Echten und Falschen Mehltau. Da die Weinrebe jene Kulturpflanze ist, die wegen des Pilzbefalls am häufigsten gespritzt wird, haben die PIWIs einen entscheidenden Vorteil gegenüber herkömmlichen Rebsorten. Sie müssen gar nicht mehr bzw. nur noch selten gespritzt werden. Deshalb werden sie vor allem im biologischen Anbau immer häufiger eingesetzt und sind auch ein wichtiger Baustein der Delinat-Methode.
Parasiten sorgten für eine Katastrophe
In der frühindustriellen Zeit bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts sah der Weinbau noch völlig anders aus als heute. In den Weinbergen war es üblich, dass man die Rebsorten in Gemischten Sätzen anbaute. Man pflanzte also viele verschiedenen Sorten, die gemeinsam geerntet und zu Wein verarbeitet wurden. Die Vielfalt der Rebsorten übertraf die heutige Anbauweise um ein Vielfaches. Reben wurden in sélection massale, also per Hand vervielfältigt, Reiser für Reiser. Ob die Weine damals schmackhafter waren, darf zwar bezweifelt werden. Was man allerdings sehr sicher sagen kann, ist, dass die Weinberge natürlicher, vielfältiger und gesünder waren.

Doch ab der Mitte des 19. Jahrhunderts brach innerhalb von wenigen Jahren die Katastrophe über den europäischen Weinbau herein. Rebsorten, die Auswanderer einst mit in die USA genommen hatten, wurden von Botanikern und auch Missionaren zurück nach Europa gebracht. Was damals niemand ahnte: Sie hatten Rebläuse und Krankheiten mit im Gepäck, die es in Europa vorher nicht gab. Innerhalb kürzester Zeit vernichteten die Parasiten sowie der Echte und der Falsche Mehltau die meisten Weinbergsflächen und entvölkerten dadurch ganze Landstriche. Der Weinbau sollte sich entscheidend verändern.
Mit Forschung gegen Pilz-Krankheiten
Forschungseinrichtungen arbeiteten fieberhaft an Lösungen. Gegen die Reblaus, gr./lat. Phylloxera vastatrix, fand man die Lösung in Form der amerikanischen Unterlagsreben. Dies sind Stämme amerikanischer Wildreben, die resistent sind gegen die Reblaus. Rund 99 Prozent aller Rebstöcke weltweit bestehen heute aus diesen Unterlagsreben sowie den Edelrebsorten, die auf die Unterlagsreben gepfropft sind. Gegen die Pilzkrankheiten des Echten Mehltaus (Oidium) sowie des Falschen Mehltaus (Peronospora) halfen lange Zeit nur Schwefel und die sogenannte Bordelaiser Brühe, eine Mischung aus Kupfersulfat, Kalk und Wasser.
Sowohl Schwefel als auch Kupfer werden auch heute noch im biologisch-organischen Weinbau eingesetzt. Denn leider hat man im biologischen Landbau bisher keine ökologisch akzeptable Alternative zum Schwermetall Kupfer gefunden. Der konventionelle Weinbau dagegen hat sich mit dem Aufkommen der chemischen Industrie völlig verändert. Wo früher Vielfalt im Weinberg herrschte, findet man heute eine Monokultur von geklonten Rebsorten, die sortenrein im Weinberg stehen. Die Rebsortenvielfalt vor der Reblaus-Katastrophe reduzierte sich auf wenige Dutzend vorherrschender Rebsorten. Der Kunstdünger, dessen Erfindung ein direktes Resultat der Kampfstoffproduktion des Ersten Weltkrieges war, hielt Einzug in die Weinberge und versorgte die Reben mit Nährstoffen. Die Folge dieser kontinuierlichen Düngung im Oberboden ist, dass die Reben nicht mehr tief in den Unterboden wurzeln. Sie müssen nicht mehr kämpfen, doch das ist eine der wichtigsten Eigenschaften der Weinrebe und führt zu ausdrucksstarken Weinen. Die beständige Düngung des Oberbodens schwächt die Weinrebe und sie ist dadurch den Parasiten weitgehend hilflos ausgeliefert. Doch auch dafür hatte die chemische Industrie irgendwann eine Antwort. Herbizide, Pestizide und Fungizide hielten vor allem ab den 1950er Jahren grossflächig Einzug in Landwirtschaft und Weinbau.
PIWI-Züchtung statt Chemie
Parallel zu den Entwicklungen der chemischen Industrie jedoch gab es schon bald nach dem Auftreten der importierten Parasiten Bestrebungen, die Herausforderungen durch Züchtung zu lösen. Zunächst griff man auf amerikanische Züchtungen zurück. Bei diesen sogenannten Hybriden wie Noah, Delaware oder Clinton hatte man amerikanische Wildreben mit Edelreben gekreuzt. Diese Kreuzungen hatten jedoch einen Nachteil. Man verstand es damals noch nicht, den sogenannten Foxton aus den Reben herauszukreuzen. Der Foxton, der tatsächlich aromatisch mit den Ausdünstungen eines Fuchses zu vergleichen ist, ist den Wildreben eigen. Und das macht sie weitgehend ungeniessbar. Der Mangel an Qualität hat den durchschlagenden Erfolg der frühen Hybridreben verhindert.

Erst neue, in Frankreich gezüchtete Sorten wie Léon Millot, Ravat blanc, Jacquet, Maréchal Foch oder Seyval blanc brachten einen Durchbruch. 1958 standen in Frankreich auf 402'000 Hektar Hybride in den Weinbergen und damit auf mehr als 30 Prozent der gesamten Anbaufläche. Doch die Regierung des wichtigen Weinlandes Frankreich versuchte die weitere Ausbreitung der Hybridreben durch Erlasse, Gesetze und Abgaben zu verhindern. Die Anmeldung neuer Sorten wurde so teuer, dass Rebenzüchter davon abliessen und der Anbau von Hybridreben in Frankreich völlig zum Erliegen kam.
Akzeptanz der PIWIs und rechtliche Probleme
Tatsächlich ist die Geschichte der Hybridreben bzw. PIWIs in Frankreich so etwas wie eine Leidensgeschichte. Trotz der Züchtungserfolge, die für zunehmende Akzeptanz der Sorten und entsprechend auch für einen Rückgang von Pflanzenschutzmitteln sorgten, führte ein Dekret vom 30.9. 1955 dazu, dass Winzer für ihre Tischweine nur noch bestimmte Rebsorten nutzen durften. Das Dekret sah «empfohlene Sorten», «zugelassene Sorten» sowie «tolerierte Sorten» vor. Schon die zugelassenen, besonders aber die tolerierten Sorten durften nur noch in kleinen Mengen angebaut werden. 1979 schliesslich mussten auch die ehemals tolerierten Sorten gerodet werden, sodass es in Frankreich de facto so gut wie keine Hybridreben mehr gab. Denn nur sehr wenige Hybride hatten es in die Liste der zugelassenen Sorten geschafft, und es kamen keine neuen hinzu. Ausserdem gab es schon vor diesem Datum Rebsorten, deren Anbau explizit verboten war. Dazu zählten vor allem die ursprünglich amerikanischen Hybride. Jahrzehntelang hat die französische Regierung die Rodung dieser Hybride betrieben. Schliesslich sind nur an der Ardèche einige wenige Hektar dieser Sorten übriggeblieben, die eine Sondergenehmigung des Landwirtschaftsministeriums erhalten hatten. Ähnlich war es übrigens in Österreich. Dort hat der Uhudler überlebt, obwohl er zwischenzeitlich verboten war. Diese regionale Spezialität ist eine Cuvée aus den alten Hybriden Concord, Elvira, Isabella, Noah, Otello und Ripotella.
Langsame Ausbreitung und neue PIWI-Züchtungen
Bis heute gibt es in der EU deutliche Vorbehalte gegenüber PIWIs. Das offizielle Hauptargument ist, dass diese Sorten genetisch unter anderem aus amerikanischen oder auch asiatischen Wildreben bestünden, was es unmöglich mache, aus ihnen europäischen Qualitätswein zu erzeugen. Immerhin aber ist die Produktion von Tafelweinen erlaubt. In Frankreich ist das Thema Hybride bzw. PIWIs immer noch weitgehend tabu, auch wenn Delinat mit ihrem provenzalischen Weingut Château Duvivier weiter Pionierarbeit leistet und französischen Winzern die Vorteile der PIWIs wieder näherbringt.
Doch andernorts hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Die Züchtung von PIWIs erfolgt heute in Deutschland in Geisenheim, Siebeldingen und Freiburg, in Österreich in Klosterneuburg und Eisenstadt, ferner in Ungarn und weiteren Ländern Osteuropas sowie auch in den USA und in Kanada. Während man in der Schweiz lange Zeit seitens der Behörden sehr zurückhaltend mit den PIWIS war, hat sich dort der Wind gedreht.
Führende PIWI-Züchter
Mit Dr. Pierre Basler und Valentin Blattner leben zwei der führenden PIWI-Forscher und Züchter in der Schweiz. Es war Pierre Basler, der 1995 die ersten PIWI-Sorten im Delinat-Weingarten von Château Duvivier in der Provençe gepflanzt hat. Er hat das damals gegen den Widerstand der Chambre d’Agriculture durchgesetzt, konnte sie schliesslich aber doch für sein Pilotprojekt gewinnen. 2003 erkrankte Pierre Basler und konnte seitdem seine Arbeit nicht mehr fortsetzen.

Umso intensiver und erfolgreicher bei der Züchtung und Veredlung neuer Sorten war Valentin Blattner (siehe auch die Beiträge im Videoblog «Weinbau der Zukunft»). Der aus Basel stammende Züchter lebt seit den späten 1980er Jahren im abgeschiedenen jurassischen Ort Soyhières. Das recht kühle und feuchte Klima des Ortes, in dem vor ihm niemand auf die Idee kam, Reben zu pflanzen, sieht er als ideal an: »Reben, die in unserem feuchten Mikroklima ohne Krankheiten gedeihen, schaffen das in den meisten Weingebieten erst recht.«
Mit Josep Maria Albet i Noya, einem der uns vertrautesten Winzer, mit dem Delinat seit Jahrzehnten zusammenarbeitet, hat er im Penedès ein Langzeitprojekt gestartet. Bei Albet i Noya geht es darum, zwei sehr alte Rebsorten mit hoher Pilzwiderstandsfähigkeit mit jüngeren Rebsorten zu kreuzen. Die rote Sorte Belat (ein Anagramm von Albet) sowie die weisse Sorte Rión hat Josep Ende der 1990er Jahre in einem alten Weinberg der Familie gefunden. Mit der Hilfe von Blattner kreuzt er die Sorten mit jüngeren Rebsorten wie Xarello, Macabeu oder Parellada, um neue, schmackhafte Sorten zu gewinnen, die gleichzeitig in hohem Masse pilzresistent sind.
Gebräuchliche PIWI-Rebsorten und deren Qualität
Bei der Neuzüchtung von PIWIs ist vieles zu beachten. Doch der entscheidende Punkt ist der spätere Geschmack. Eigentlich ist es für einen Züchter kein Problem, verschiedene Rebsorten miteinander zu kreuzen. Man nimmt dafür eine amerikanische und vielleicht zusätzlich noch eine frostresistente asiatische Wildrebe. Man kreuzt diese dann mit einer Edelrebe und erhält im besten Falle ein Ergebnis, das im Weinberg überzeugt. Doch setzen sich von den vielen Versuchen immer nur wenige wirklich gelungene Kreuzungen durch.
Blattner war erfolgreich mit dem Cabernet Jura, dem Cabernet Blanc, dem Pinotin und verschiedenen weiteren Sorten, die momentan noch Kürzel aus seinem Versuchslabor tragen. Viele der erfolgreichen Reben tragen in ihrem Namen die Sorten, von denen sie abstammen. So ist ein Elternteil von Cabernet Jura und Cabernet Blanc, von Cabertin oder Cabernet Cortis natürlich der Cabernet Sauvignon. Auch bei Pinotin, Muscaris, Souvignier Gris oder Chardonel kann man sich einen Elternteil denken. Schwieriger wird es bei Solaris, Phoenix, Bianca oder Saphira.
Tatsächlich sind es manchmal auch genau diese Kunstnamen, die bei Weintrinkern auf gewisse Vorbehalte treffen, da sie die Sorten nicht kennen und auch nicht einordnen können. Einfacher scheint es bei Namen wie Johanniter, Chambourcin oder Merzling zu sein, die eher historisch klingen. Tatsächlich gehört der Johanniter zu den älteren PIWIs und stammt aus dem Jahr 1968. Noch älter und weit verbreitet ist der Seyval Blanc aus dem Jahr 1919. Diese Sorte findet man sowohl in Mitteleuropa als auch vor allem in England, Kanada und in verschiedenen Teilen der USA.
Eine typische Rebsorte in deutschen Weingärten ist dagegen der Regent, der sich grossflächig durchgesetzt hat. Mit der zunehmenden Verbreitung in vor allem biologisch gepflegten Weinbergen findet man PIWI-Weine immer häufiger, auch mit hoher Bepunktung in Weinwettbewerben. Dabei wird vor allem das immer mehr zum Markenzeichen, was früher als Manko galt: der eigene Geschmack. Viele Weinliebhaber sind auf der Suche nach charakterstarken Weinen und den damit verbundenen Rebsorten. Sie möchten die grosse Vielfalt erkunden, die der Wein bietet, und eben nicht immer die gleichen Rebsorten im Glas haben. Diese Vielfalt bieten die neuen Sorten mit den teils uralten Genen.
PIWI-Weine im Test: Delinat-Sommelier Dirk Wasilewski degustiert Weine von robusten Rebsorten
Best Practice – das Schweizer Weingut Lenz
Das beste Beispiel für den erfolgreichen Anbau und Verkauf von PIWIs geben Karin und Roland Lenz. Das Schweizer Winzer-Ehepaar setzt voll auf PIWIs und zugleich auf die Delinat-Methode. Pilzresistente Reben und Biodiversität sind für die beiden die entscheidenden Kriterien für einen nachhaltigen Wandel im Weinberg. Seit der Jahrtausendwende haben sie Erfahrung mit zwei Dutzend pilzresistenten Sorten gesammelt.

Diese Sorten entwickelten sich ganz unterschiedlich im Weinberg, sagt Roland Lenz. Manche blieben ihr Leben lang zu 100 Prozent pilzresistent, andere, wie etwa der Regent, verlören die Resistenz zu einem gewissen Grad. Sie bleibe jedoch so hoch, dass die Winzer lediglich mit Backpulver und Tonerde gegen den Echten und Falschen Mehltau vorgingen. Schwefel oder gar Kupfer hätten sie dort seit vielen Jahren nicht mehr ausgebracht.
Beim Müller-Thurgau oder Pinot Noir, den sie bei Gründung des Weinguts übernommen hätten, sehe dies anders aus. Der benötige bis zu 17 Behandlungen mit Kupfer pro Jahr, was bis zu 2,5 Kilo Reinkupfer pro Hektar entspreche. Auch wenn das Kupfer chemische Mittel ersetze und deshalb in gewisser Weise «besser» sei, reicherten sich doch Schwermetalle im Boden an, welche die Winzer dort eigentlich nicht haben wollten. Deshalb würden im Weingut Lenz alle europäischen Reben nach und nach durch PIWIs ersetzt – zur Freude der Kunden, die diesen Weg längst mitgingen.
Die PIWIs als Teil der Delinat-Methode
So ist es auch bei Delinat, wo man froh ist, dass dieKunden den strikten Weg, den Delinat mit seiner Methode eingeschlagen hat, mitgehen und fördern. Denn bio ist nicht gleich bio. Der biologische Anbau nach EU-Richtlinien unterscheidet sich eklatant von der Delinat-Idee einer biologischen und nachhaltigen Bewirtschaftung. Der Weinbau benötigt ein Zurück zu manchen Methoden, die vor der Industrialisierung der Landwirtschaft völlig normal waren. Und zugleich benötigt er die Ergebnisse moderner Forschung und Entwicklung.
Ein entscheidender Faktor ist der Aufbau eines komplexen Bodenlebens mit Pflanzen, Pilzen und Mikroorganismen, statt diese mit Kunstdünger und Breitbandherbiziden zu vernichten. Ein weiterer Schritt ist die Schaffung von Vielfalt im Weinberg. Die Urahnen unserer Winzer haben das gar nicht anders gekannt. Vielfalt bedeutet eine Erzeugung von Gleichgewicht und stärkt die Pflanzen. Ebenso wichtig ist der Rückgriff auf altes Genmaterial, auf Diversität auch bei den Rebsorten sowie der Vormarsch der PIWI. Sie können entscheidend dazu beitragen, dass Weinberge, die wie dahinsiechende Kranke wirken, wieder zu blühendem Leben erwachen.