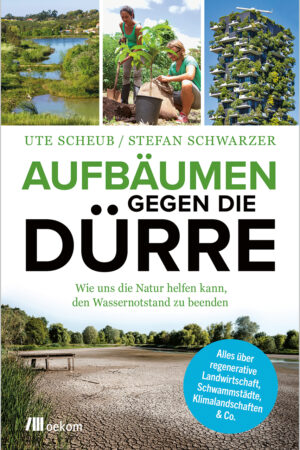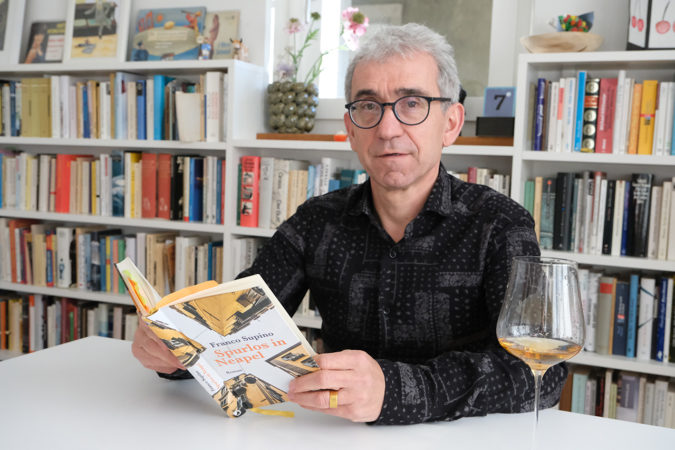Rosé ist belanglos, minderwertig und charakterschwach: Über keinen anderen Weintyp wird mehr Unsinn erzählt. Fünf bekennende Rosé-Fans erzählen, warum Roséweine viel besser sind, als ihr Ruf. Das Fazit schon einmal vorweg: Rosé-Weine haben bei der Qualität enorm zugelegt, sie sind längst keine Weine zweiter Klasse mehr und eignen sich verblüffend gut als vielseitige Speisebegleiter.

Vorurteil 1: Rosé ist ein belangloser Terrassenwein
Gelungene Rosés schaffen das Kunststück, die guten Eigenschaften von Weissweinen (Frische, saftiger Schmelz) mit den Qualitäten der Rotweine (Struktur und Rückhalt) zu vereinen. Dabei galten Rosés tatsächlich lange Zeit als «Abfallprodukte» der Rotweinherstellung. Denn klassischer Rosé war das Resultat einer Vorlese von nicht ganz einwandfreien oder nicht ganz ausgereiften Trauben. Oder eben ein Nebenprodukt der Herstellung von Spitzenweinen. Nach diesem Saignée genannten Prinzip wird aus den Gärbehältnissen, in denen die besten Rotweine vinifiziert werden, ein Teil des frei ablaufenden Safts abgezogen und zu Rosé verarbeitet.
Doch die heutigen Top-Rosés sind längst keine Abfall- oder Nebenprodukte mehr! Durch die Klimaerwärmung und die akribische Arbeit der Winzer im Rebberg sind früher gelesene Trauben für die Rosé-Produktion heute nicht mehr grün, beschädigt und deshalb zweitklassig, sondern einfach ein bisschen weniger konzentriert. Zum Glück! Denn so entstehen selbst in warmen Jahren, animierende Rosé-Weine mit Frische und Finesse. Auch die Saignée-Methode bringt heute bessere Rosés hervor. Weil Saignée-Rosés ja aus voll ausgereiften Toptrauben entstehen, wiesen die entsprechenden Weine lange Zeit einen vergleichsweise hohen Alkoholgehalt auf. Weil nun aber immer mehr Winzer den Alkoholgehalt ihrer Topweine zurückfahren, haben auch die Saignée-Rosés deutlich an Lebendigkeit und Eleganz gewonnen.
Gute Rosés bluffen nicht mit kitschig parfümiert wirkender Aromatik und Restsüsse im Gaumen. Nein, ein guter Rosé besticht mit einem Anflug von rotbeerigem Fruchtschmelz und einer saftigen Säure. Er muss meiner Meinung nach gut gekühlt, am besten so um die acht Grad Celsius (auch wenn in Fachbüchern immer noch 12 Grad empfohlen werden) serviert werden, am besten mit Kühlmanschette oder im Eiskübel.
So machen die neuen Rosés nicht nur zum Apéro viel Spass. Sie sind auch hervorragende Essensbegleiter. Glauben Sie mir: Wer erst mal damit anfängt, Rosés mit verschiedensten Arten von Gerichten zu kombinieren, der erlebt den Beginn einer wunderbaren Freundschaft! Und weil Europa eine so gewaltige Vielfalt an Rosé-Gewächsen hervorbringt, hält diese Freundschaft locker ein ganzes Leben lang… Übrigens können Sie gute Rosés ganz leicht von mittelmässigen Gewächsen unterscheiden. Denn bei guten Rosés ist das Glas immer leer, bevor der Wein darin zu warm geworden ist.
Vorurteil 2: Rosé ist eine Mischung aus Rot- und Weisswein

Das ist ein weit verbreiteter Irrtum: Rosé entsteht nicht, indem Weisswein mit Rotwein vermischt wird. In der EU und in der Schweiz ist ein solcher Verschnitt sogar verboten. Die Herstellung von Rosé ist also komplizierter und zählt heute zur hohen Kunst der Weinproduktion. Grundsätzlich ist es so: Bei der Rosé-Erzeugung werden Rotweintrauben wie Weisswein vinifiziert. Das heisst, man erntet die roten Trauben, presst sie mehr oder weniger sofort ab oder lässt sie «bluten». Anschliessend lässt man den Saft vergären. In einigen Appellationen darf auch ein Anteil Weissweintrauben verwendet werden. In unserem Château Duvivier war dies in manchen Jahrgängen der Fall. Der aktuelle Cuvée des Amis ist rein aus roten Trauben gekeltert.
Geläufig sind zwei verschiedene Herstellungsverfahren: Bei der Direktpressung, in Frankreich Pressurage direct genannt, lässt der Kellermeister die Rotweintrauben so lange auf der Maische liegen, bis sich die von ihm gewünschte Farbe für den Rosé einstellt. Dann wird abgepresst, und der Most wird wie ein Weisswein vinifiziert.
Die zweite Methode ist das sogenannte Bluten, bei uns Saignée genannt. Bei dieser Methode spielen die Trauben ein doppeltes Spiel. Sie bleiben vorerst eine kurze Zeit gekühlt in einem Tank liegen (meist nicht länger als 24 Stunden) und beginnen alleine durch ihr Eigengewicht zu «bluten» (saigner). Der so entstehende, meist hellrosarote Saft wird abgezogen und wiederum wie ein Weisswein vinifiziert. Durch den Saftabzug für den Rosé wird die Maische in Farbe, Tanninen und Geschmacksstoffen konzentriert. Daraus entsteht dann zusätzlich noch ein Rotwein.
Der Kellermeister kann Farbe und Geschmack beim Rosé auf verschiedene Arten beeinflussen: zum Beispiel durch die Wahl der Traubensorte. Es gibt Sorten, die nur wenig Farbstoffe enthalten (z.B. Cinsault), und solche, die farbintensiv sind (z.B. Syrah). Oder durch die Kelterung: Je länger die Trauben an der Maische bleiben, desto dunkler wird der Wein.
Entscheidend für die Herstellung eines guten Rosés ist der richtige Erntezeitpunkt der Trauben. Wird zu spät geerntet, hat der Wein zu wenig Säure und zu viel Alkohol, bei zu früher Ernte drohen grüne Noten und zu wenig Aromen.
Vorurteil 3: Gute Rosé-Weine gibt es nur in Frankreich

Einst als Kopfschmerz-Wein verschrien, ist Rosé längst in der Weinwelt angekommen. In Frankreich wird mittlerweile bei den stillen Weinen mehr Rosé als Weisswein getrunken. Neben Baguette und Baskenmütze ist Rosé zu einem Symbol für französische Lebensart geworden.
Die Provence ist das grösste und bekannteste Weinbaugebiet für Rosé-Weine. Diese Weine haben hier eine lange Tradition – die Provence gilt als Heimat des Rosé. Die hellen Tropfen werden aus den roten Rebsorten Cinsault, Grenache und Syrah gekeltert. Auf Château Duvivier entsteht nach der Saigneé-Methode die Cuvée des Amis rosé. Diese hat nicht nur bei den Gästen des Châteaus Kultstatus. Aber am besten schmeckt sie halt doch vor Ort zum Sonnenuntergang.
Zu glauben, gute Rosés seien eine Exklusivität Frankreichs, ist aber ein Trugschluss. In weiten Teilen Europas, etwa in Spanien, Portugal und Italien, ziehen Winzer mit ausgezeichneten Rosados und Rosatos nach. Die grosse Nachfrage, die verbesserte Kellertechnik sowie die Selektion der Trauben speziell für Rosé haben die Qualität der Weine in den letzten Jahren europaweit deutlich verbessert. Heute gibt es aus allen wichtigen Weinländern hervorragende Rosé-Weine, die sich auch bestens als Essensbegleiter zu Fisch, Fleisch, Käse und zur asiatischen Küche eignen.
Auf zwei meiner Lieblings-Rosés ausserhalb Frankreichs möchte ich speziell hinweisen: Der portugiesische Vale de Camelos Rosé, aus der roten Traube Aragonez (Tempranillo) gekeltert, punktet mit seiner reifen Beerenaromatik und seiner kräftigen Struktur und passt bestens zu einem gebratenen Makrelenfilet mit gedünsteten Tomaten und Fenchel. Und der Cantarana von Albet i Noya aus Katalonien ist inzwischen auch ein Klassiker im Delinat-Sortiment. Mit seinen fruchtigen Aromen nach roten Beeren und Zitrusfrüchten erweist er sich nicht nur als perfekter Begleiter für laue Sommerabende auf der Terrasse, sondern auch als vielseitiger Speisebegleiter zu kleinen Häppchen.
Lassen Sie Ihre Baskenmütze getrost im Schrank, und geniessen Sie Rosé-Weine aus ganz Europa, und zwar das ganze Jahr über. Nur gut müssen sie sein. Dafür bürgen unsere Winzer aus ganz Europa.
Vorurteil 4: Rosé trinkt man nur zum Apéro

Um es gleich vorwegzunehmen: Bei Rosé-Weinen denke ich zuerst an wunderbare Essensbegleiter. Und eben nicht in erster Linie an Apéro. Privat trinke ich Rosé zum Essen. Aber auch bei Caterings empfehle ich Rosé häufig zur Vorspeise oder zum Hauptgang. Warum eigentlich?
Das hat wohl mit meiner Wein-Sozialisation zu tun: Ein atemberaubendes Rosé-Erlebnis hatte ich vor einigen Jahren in den Ferien auf Ibiza. An jenem Abend sassen wir zum Essen in einem Orangenhain. Es wurden Rindfleisch und verschiedene Gemüse auf dem offenen Feuer gebraten. Dazu bestellten wir, mehr zur Abwechslung, einen Rosado. Dieser Rosé-Vertreter leuchtete uns in einem intensiven, dunklen Pink entgegen und überraschte mit seiner Fülle und der angenehmen Barriquenote. Für mich war das ein unvergessliches Geschmacksvergnügen, das meine Genuss- und Weinbiografie nachhaltig beeinflussen sollte.
Nach und nach habe ich die Vielfalt der Rosé-Weine kennen und schätzen gelernt. Nur schon das farbliche Spektrum imponiert von hellblassen Lachsnoten bis zu tiefen Kirschtönen. Aber auch der geschmackliche Reichtum von sehr leichten bis zu intensiv fruchtigen und gehaltvollen Rosé-Weinen lädt uns geradezu ein, Kombinationen mit verschiedenen Gerichten zu versuchen.
Und wozu schmeckt Rosé nun am besten? Ich finde ihn wunderbar zu allen Grilladen. Hier ist die Palette an Alternativen breit: sei es nun Fisch, Meeresfrüchte, Fleisch, Wurst (traumhaft zu Salsiccia mit Fenchelsamen vom Grill) oder auch Halloumi. Absolut umwerfend schmeckt Rosé zu grilliertem Gemüse und überhaupt zu allen Gemüsegerichten.
Schon klar: Die Wahl des «passenden» Weines ist Geschmackssache. Zu kräftigeren Speisen und Grilladen darf es ruhig ein kräftiger Rosé sein. Zu dezenteren Gerichten serviere ich einen leichten Rosé. Zum Apéro kann es auch ein Rosé-Schaumwein sein. Ist die Vorspeise eine Ziegenkäse-Mousse mit exotischem Dattel-Tatar, wäre als Weinbegleitung ein Rosé naheliegend. Aber auch zu einem deftigen Linseneintopf mit Kokosmilch, Gemüse und einer Lieblings-Currymischung empfehle ich wärmstens einen schweren Rosé-Wein, der dann nicht ganz so kalt serviert wird. Rosé ist nicht gleich Rosé. Nur Mut: Wer sich an neue Geschmackskombinationen wagt, wird belohnt werden.
Und noch etwas: Wer sein Interesse an Rosé nur auf die heissen Sommertage reduziert, ist selber schuld. Selbstredend empfehle ich Rosé über das ganze Jahr hinweg. Sei es nun zu einem Apéro, zu Tapas, einer handgefertigten Salami oder einem orientalischen Gericht.
Vorurteil 5: Rosé kann man nicht lagern

Die Lagerfähigkeit eines Weines hängt von verschiedenen Faktoren ab. Je mehr Tannin, Süsse und Säure enthalten sind, desto länger ist ein Wein haltbar. Auch das Alter und die Lage der Rebstöcke spielen eine Rolle.
Rosé verdankt seine helle, rosarote Farbe einer kurzen Mazeration. Das heisst, die farbgebenden Beerenhäute liegen nur kurze Zeit auf der Maische, werden also rasch abgepresst. Dadurch gelangen nur wenig natürliche Konservierungsstoffe wie Farbe und Tannin in den Wein. Ausserdem werden für die Erzeugung von Rosé oft Trauben von noch jungen Reben verwendet, die auch für alkoholarme und leichte Rotweine geeignet sind.
Rosé lieben wir, weil er fruchtig, frisch und unkompliziert ist. Er enthält wenig Alkohol, Gerbstoffe und Säure. Dank dieser Eigenschaften schmeckt ein solcher Wein kurz nach der Abfüllung am besten. Er sollte innert ein bis zwei Jahren getrunken werden. In den meisten Fällen trifft es also zu, dass Rosé nicht über mehrere Jahre gelagert werden sollte. Er bleibt zwar trinkbar, wirkt aber oft plump und lässt die für Rosé typische Frucht und Frische vermissen.
Ausnahmen bilden Rosés, die einen kräftigeren Körper haben und oxidativ – zum Beispiel im Barrique – ausgebaut sind. Sie haben eine längere Lagerfähigkeit. Optimal für die Lagerung ist ein kühler, dunkler Keller, in dem sich die Temperatur grösstenteils konstant hält. Eine Durchschnittstemperatur von 10 bis 12 Grad ist ideal.
Fazit: An den Rosés mögen wir die Primäraromatik, also ausgeprägte Fruchtaromen und Frische. Diese kommen in den ersten ein bis zwei Jahren nach der Ernte am besten zur Geltung. Deshalb meine Empfehlung: Rosé jung trinken!
DegustierService Rosé
Rosé-Weine, die weit mehr sind als einfache Apéro oder Terrassenweine: Die Delinat-Winzer haben die Rosé-Erzeugung zur hohen Weinkunst erklärt. Mit dem DegustierService Rosé gelangt zweimal pro Jahr ein Paket mit drei Roséwein-Entdeckungen unserer Einkäufer portofrei zu Ihnen nach Hause geliefert: www.delinat.com/weinabo