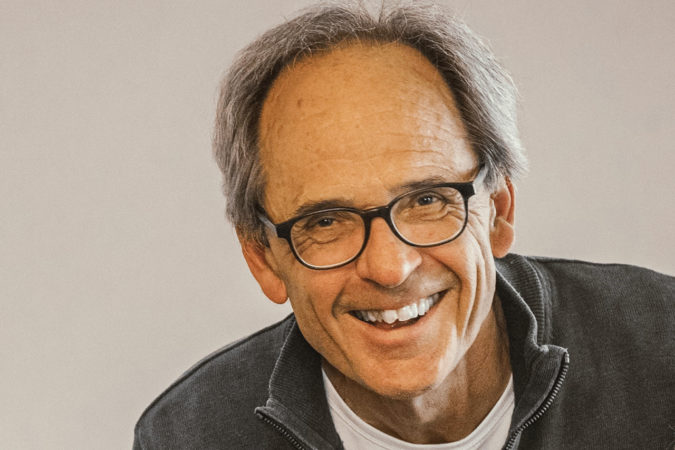Naturköchin Rebecca Clopath (34) kocht auf ihrem abgelegenen Biobauernhof Taratsch im Bündner Bergdorf Lohn mithilfe der Natur auf Sterne-Niveau. Wir unterhielten uns mit ihr bei einem Glas Wein über kulinarische Erlebnisse, die sie ihren Gästen in Form von Esswahrnehmungen anbietet.
Sie kommen gerade von einer Weiterbildung aus Dänemark zurück. Was kann eine gestandene, hochgelobte Schweizer Naturköchin dort noch lernen?
Rebecca Clopath: Man kann immer noch was dazulernen. Ich habe vier Wochen in einem Restaurant eines Freundes mitgearbeitet. Kochtechnisch ist für mich hier nicht gerade die Sonne aufgegangen. Aber ich bin ja nicht nur Köchin, sondern auch Unternehmerin. Neues zu sehen und Einblick in andere Strukturen zu haben, ist immer wertvoll.
Wollten Sie schon immer Köchin werden?
Ich habe immer gerne gut gegessen. Meine Mutter hat super fein gekocht und mir das Kochen beigebracht. Mit 14 hatte ich bereits meine Lehrstelle, sodass ich dann nach der Schule eine Ausbildung zur Köchin beim bekannten «Chrüter-Oski» in der Moospinte in Münchenbuchsee machen konnte.

Kochlehre bei Oskar Marti, später Köchin beim «Hexer» Stefan Wiesner im Entlebuch. Wie stark haben Sie diese beiden Spitzenköche, die in der Schweiz für gehobene Naturküche stehen, beeinflusst?
Das Interesse an der Natur wurde bei mir schon als Kind geweckt. Wir hatten keinen Fernseher, ich war viel draussen in der Natur, und meine Mutter hat vor allem mit Produkten vom eigenen Hof und Garten gekocht. Oskar Marti war damals für seine Kräuterküche bekannt. Deshalb habe ich mich beworben und bekam die Lehrstelle. Dort wurde das Interesse, mit saisonalen Produkten aus der Natur zu kochen, noch grösser. Später konnte ich das dann bei Stefan Wiesner in einer ganz neuen Art vertiefen und weiter ausleben.
Wie stark ist Ihre Küche von der Philosophie von Stefan Wiesner geprägt?
Stefan Wiesner ist ein Philosoph, ein Alchemist, ein Künstler. Das Kochen ist für ihn vor allem ein Ventil. Ich bin von ganzem Herzen Köchin. Mich interessiert, was geschmacklich auf dem Teller landet. Ich arbeitete ausschliesslich mit regionalen, biologischen Produkten, auch bei den Gewürzen. Aber natürlich bin ich geprägt von Wiesners Ansichten, weil seine Inputs, wie man die Parfümerie oder die Alchemie in die Küche integrieren kann, sehr spannend sind.
Bio und regional, das ist Ihr Markenzeichen?
Genau. Es geht mir aber nicht darum, die Globalisierung in der Küche zu verteufeln, sondern ich möchte zeigen, dass es bei uns fantastische Produzenten gibt, die viel Biodiversität in die Landschaft und verschiedene Geschmäcker auf den Teller bringen.»
Ist es der bessere Geschmack oder eher die Nachhaltigkeit, die für Bio-Produkte sprechen?
In erster Linie ist es für mich der Respekt vor der Natur, den ein biologischer Anbau mit sich bringen sollte und dies im Normalfall auch tut. Wir dürfen auf diesem Erdball leben und sollten dafür dankbar sein. Diese Überzeugung lebe ich. Gleichzeitig bin ich aber schon auch der Meinung, dass biologische Produkte geschmacklich besser sind.
Rebecca Clopath, Jahrgang 1988, ist auf dem Biohof Taratsch im Bergdorf Lohn in Graubünden aufgewachsen. Schon früh entdeckte sie ihre Liebe zur Naturküche. Nach Lehr- und Wanderjahren bei den bekannten Naturköchen Oskar Marti in Münchenbuchsee und Stefan Wiesner in Escholzmatt kehrte sie in ihre Heimat zurück und übernahm den elterlichen Biohof Taratsch. Hier begann sie, als Biobäuerin und Naturköchin Landwirtschaft und Kulinarik zu kombinieren. Aus regionalen und biologischen Rohstoffen stellt sie viele verschiedene Produkte her und bietet Esswahrnehmungen in Form von Mehrgangmenüs an. In Chur führt sie zusammen mit Romina Crameri den Feinkostladen Cramerei, wo ihre eigenen, aber auch andere Bioprodukte aus der Region angeboten werden.
www.rebecca-clopath.ch
Sie kochen nicht in einem Gourmettempel, sondern bieten auf Ihrem Biohof sogenannte Esswahrnehmungen an. Was ist darunter zu verstehen?
Fast alles, was wir als Biobauern auf unserem Hof produzieren und in der Natur an Essbarem finden, verarbeiten wir in der Küche zu feinen Gerichten. Weil Gourmetküche und Sternerestaurant nicht so mein Ding sind und auch nicht in unsere Umgebung passen würden, habe ich das Konzept der Esswahrnehmung entwickelt. Es geht darum, den Leuten ein kulinarisches Erlebnis mit fein komponierten Kreationen und spannenden Geschichten aus der alpinen Region zu bieten. Die Gäste sollen bewusst wahrnehmen können, wie das, was auf dem Teller präsentiert wird, entsteht, woher es kommt und welche Prozesse dahinterstecken.
Welche Beziehung haben Sie zu Wein?
Wein war für mich als Köchin recht lange Zeit kein sehr grosses Thema. Ich habe zwar immer gerne Wein getrunken und fand es auch immer spannend, Wein mit Essen zu kombinieren. Aber Hintergrundwissen zu Traubensorten oder Anbaumethoden war für mich lange Zeit sekundär. Heute beschäftige ich mich jedoch intensiver damit. Wie beim Essen beschränken wir uns auch beim Wein auf die alpine Region, womöglich aus biologischem Anbau.
Welchen Traum haben Sie, den Sie noch verwirklichen möchten?
Ganz viele, aber alles ist noch sehr vage. Vorerst sind wir am das Stabilisieren, was wir hier auf unserem Biohof in Lohn aufgebaut haben. Das heisst, wir sind zurzeit in einer sehr intensiven Planungsphase.
Weintipp von Rebecca Clopath
Von drei Delinat-Weinen, die ich kürzlich gemeinsam mit Freunden degustiert habe, hat sich der Südfranzose Les Hirondelles vom Château Duvivier als Favorit herauskristallisiert. Mit Luft und Zeit ein wunderbarer Wein zu einem schönen Mittag- oder Abendessen mit Freunden.
Duvivier Les Hirondelles
Pays du Var IGP 2019
www.delinat.com/1050.19