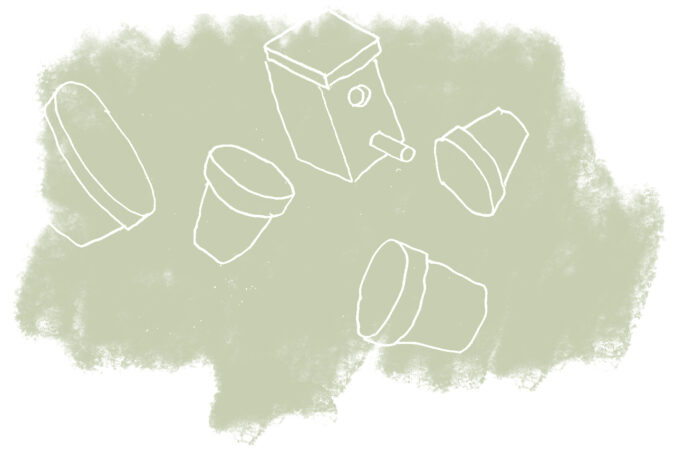Delinat hat vor mehr als 40 Jahren die anspruchvollsten Bio-Richtlinien für Weinbau in Europa definiert. Bis heute ist Delinat das einzige Unternehmen, das Biodiversität im Weingarten im Detail definiert und vorschreibt. Doch unser Nachhaltigkeitsverständnis geht weit über den Weinbau hinaus. Auch in anderen Bereichen der Produktionskette versucht Delinat, die Emissionen so gering wie möglich zu halten. Eine Übersicht über die Delinat-Methode.
Eine reiche Biodiversität

Delinat-Weinberge sind Naturparadiese mit vielen Bäumen, Sträuchern, Früchten, Beeren, Kräutern und Gemüse. Strukturelemente wie Trockenmauern, Stein- und Holzhaufen, Insektenhotels oder Biotope bilden Habitate für eine reichhaltige Insekten- und Tierwelt. All das führt zu einem stabilen Ökosystem, in dem sich die Rebe selbst vor Krankheiten schützen kann.
Lebendiger Boden

Ein lebendiger, gesunder Boden ist die Grundlage für ein natürlich funktionierendes Ökosystem mit reicher Biodiversität. Der Boden wird so gepflegt, dass Humus aufgebaut und grosse Mengen von CO2 gebunden werden. Humus und Begrünung erhöhen die Stabilität, die Wasserinfiltration und -speicherfähigkeit des Bodens, verhindern Erosion und verbessern die Fruchtbarkeit.
Intelligentes Wassermanagement

Delinat hat strenge Auflagen für die Bewässerung formuliert. Delinat-Weingüter, die ihre Reben bewässern, müssen Massnahmen ergreifen, um die Retention von Regenwasser zu verbessern. Das Ziel: Es wird nicht mehr Wasser verbraucht, als durch Niederschläge gesammelt werden kann.
Kupfer und Schwefel am Minimum

Die Delinat-Richtlinien sind die strengsten in ganz Europa, auch was den Einsatz von Kupfer und Schwefel betrifft. Zudem hat Delinat einen anspruchsvollen Absenkpfad zur weiteren Reduktion dieser Hilfsmittel formuliert. Denn gesunde Reben brauchen sehr wenig oder gleich gar keine Hilfsmittel mehr.
Resistente Traubensorten

Wir fördern gezielt die Entwicklung und den Anbau von alten, widerstandsfähigen und pilzresistenten Rebsorten. Diese liefern ohne Einsatz von Pflanzenschutzmitteln hochwertige Trauben, aus denen genussvolle Weine entstehen.
Ökologie bis ins kleinste Detail

Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur eine Worthülse, sondern essentieller Teil unserer DNA. Deshalb kümmern wir uns um jedes vermeintliche Detail: Vom Verbot von Plastikklemmen für Rebstöcke bis hin zum Verzicht von Flugreisen für Winzer-Besuche.
Erneuerbare Energien und effiziente Technologien

Delinat-Winzer verpflichten sich, einen grossen Teil ihres Energieverbrauchs aus erneuerbaren Energien selbst herzustellen. Zudem fördert Delinat den Einsatz von neuen, energieeffizienten Technologien wie etwa elektrisch angetriebenen Maschinen.
Keine Tricks im Keller

Auch im Weinkeller hat die Natur Vorrang. Hochwertiges Traubengut wird mit möglichst wenigen Eingriffen vinifiziert. Technische Verfahren, die den Wein verfälschen, sind untersagt. Maische, Rappen und Hefen aus der Vinifikation gehen, wo möglich, zurück in den Weinberg.
Ausgeklügelte Logistik

Auch in der Logistik setzt Delinat auf nachhaltige Prozesse. Die Delinat-Weine reisen wenn immer möglich auf der Schiene durch Europa. Wo möglich, wird auf Plastik als Verpackung verzichtet. Statt in Weinkartons kommen die Weine in optimierten Stapelpaletten zu uns. Alleine dadurch können 80 Prozent des Kartonmülls eingespart werden.
Lebenshilfe als Verpackungshilfe

Alle DegustierService-Pakete werden mit viel Liebe durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lebenshilfe eingepackt. Dadurch finden 26 Menschen mit psychischen und physischen Beeinträchtigungen eine sinnvolle Arbeit. Seit vielen Jahren eine schöne Win-win-Situation, an der beide Seiten ihre Freude haben.
Karton on tour

Bereits seit 2018 hat Delinat ein Mehrweg-System für Versandkartons eingeführt. Delinat-Kundinnen und -Kunden können die Kartons zurückgeben und wir schicken diese wieder und wieder auf die Reise.
Die erste Delinat-Mehrwegflasche

Mit der Einführung der Mehrwegflasche schliesst Delinat einen weiteren Kreislauf (mehr Infos zum Thema Mehrwegflasche finden Sie im Beitrag «Wie alles rund läuft»). Die Entwicklung einer eigenen Mehrwegflasche ermöglicht es, den gesamten Produktions- und Mehrweg-Prozess zu kontrollieren und zu optimieren.