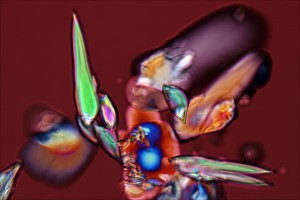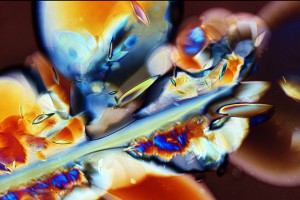Es ist schon spät, nach 21 Uhr, als wir auf dem abgelegenen Weingut Salustri zwischen Grosseto und Siena eintreffen. Nara und Leonardo Salustri, Sohn Marco und dessen Frau Antonella begrüssen und in der grosszügigen Wohnstube herzlich und bitten gleich zu Tisch. Der Küche entströmen bereits verlockende Düfte, die unseren Bärenhunger nur noch kurze Zeit auf die Folter spannen.
Ferienstimmung pur: Auf der einladenden Terrasse des Weingutes Salustri lässt sich vorzüglich ausspannen.
Wo Wildschweine nichts zu lachen haben…
Wir wussten um die begnadete Kochkunst von Nara und die Erzählleidenschaft des passionierter Biowinzers und Wildschweinjägers Leonardo. Und so sind wir nicht erstaunt, dass sich der Hausherr vor versammelter Tafelrunde ans obere Ende des Tisches setzt und keine Minute verstreicht, bis sein Jägerlatein mit ihm durchgeht. Anlass sind die feinen Wurstwaren und Schinken von hauseigenen Schweinen, die schön angerichtet zum Verzehr bereitstehen. Nebst den Hausschweinen halten Leonardo seit Jahren insbesondere die unzähligen Wildschweine in den Wäldern der Hochmaremma auf Trab.
Zurzeit hat Jagdhündin Morina weniger Wildschweine als viel mehr ihre 8 kleinen Jungen im Kopf.
«Ich habe meiner Lebtage mindestens schon 1000 Wildschweine erlegt», lacht Leonardo und zeigt stolz auf eine Wand mit Pokalen, die von seinen Schiesskünsten zeugen. Einer davon gehört allerdings seiner Jagdhündin Morina, die erst kürzlich zum zweitbesten Wildschweinjagdhund der ganzen Toskana gekürt wurde und jetzt gerade 8 Junge geworfen hat.
Ein vielversprechender, neuer Toskaner
Dann steigt Sohn Marco kurz in den Keller und kommt mit jener Flasche zurück, die der eigentliche Grund für unseren Besuch ist. Salustri gehört zu jenen Weingütern, auf denen Weinberge, Olivenhaine, Wälder, Weideflächen und wild belassene Hecken ein hochwertiges Biodiversitätssystem bilden und qualitativ hervorragende Weine erzeugt werden. Deshalb baten wir die Winzer, exklusiv für Delinat einen Wein zu keltern, der besonders typisch für die Maremma ist.
Der neue Delinat-Wein Conterocca besteht die Feuertaufe mit Bravour.
Zwar waren frühere Degustationsmuster schon vielversprechend. Als wir jetzt aber zum ersten Mal eine ausgereifte Flasche Conterocca entkorken, kommen wir aus dem Schwärmen kaum mehr heraus. Ein wunderbar frischer, gut strukturierter und harmonischer Tropfen aus Sangiovese-Trauben, ergänzt mit einem kleinen Anteil Ciliegio. Natürlich tragen auch Naras Kochkünste wesentlich zur allgemeinen Schwärmerei bei, zumal der Wein perfekt zur Küche der Maremma passt. Schon in ein paar Wochen können auch Sie die neue Weinperle aus der Toskana probieren. Freuen Sie sich auf die Conterocca-Premiere – wir informieren rechtzeitig!
PS: Wer will, kann oben beschriebene Tafelfreuden selber erleben. Salustris bieten Ferienwohnungen und einmal pro Woche eine Tavolata für Feriengäste an: www.salustri.it.